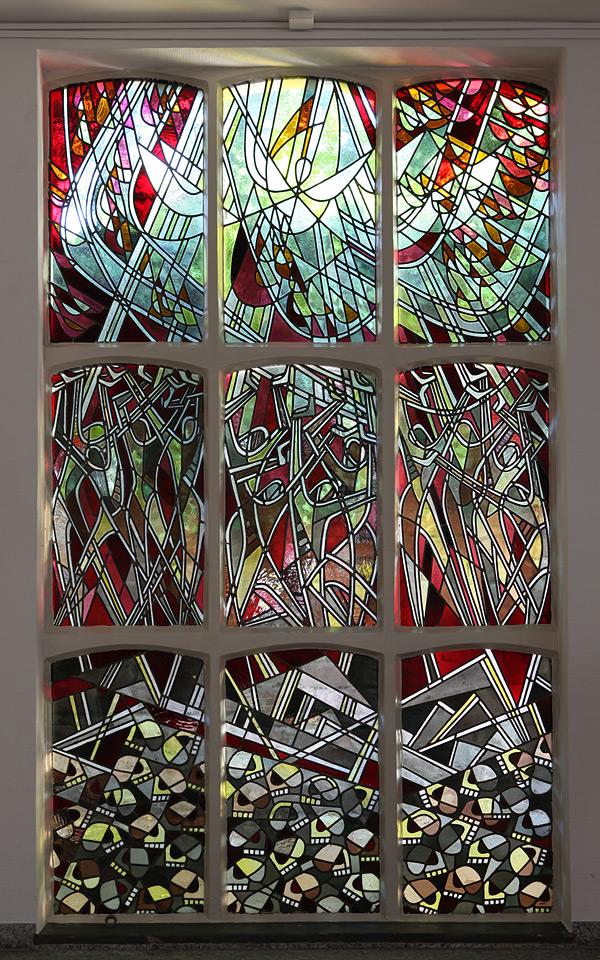Christof Grüger • Freischaffender Künstler im architekturbezogenen Bereich
Kapelle
des ökumenischen Instituts der Universität Heidelberg, Bleiglasgestaltung (1954),
Grabstele für Wolfgang Fortner auf dem Friedhof Heidelberg-Handschuhsheim
| Zu
diesem Auftrag, die Verglasung der Kapelle des ökumenischen Instituts
der Universität Heidelberg zu gestalten, kam Christof Grüger
auf Umwegen: Der Entwurf eines Altarfensters für die Johanniskirche
Magdeburg (die apokalyptischen Reiter, von einem Pfeilerstumpf zum anderen
springend - eine Verglasung als Übergang zum zerstörten Teil)
gelangte über Wolfgang Fortner, Dozent in Heidelberg am Kirchenmusikalischen
Institut, zu |
 |
|
Das
Motiv Pfingsten als ein Moment der Völkerverständigung schien
ihm passend für einen Raum, in dem Repräsentanten der unterschiedlichen
Fakultäten und Studierende aus aller Herren Länder zusammenkommen
und zudem Ökumene gelebt wird.
|
 |
 |
|
Die Vierteilung durch ein Fensterkreuz wird in der szenischen Darstellung
des Turmbaus zu Babel weitgehend unberücksichtigt gelassen. Das
Fenster gliedert sich farblich in eine, mit orange getönten Strahlen
durchsetzte, Sockelzone aus Strichmännchen in Blei, die „Menschenparteiung“,
aus der sich in Blautönen und vertikalen Linien der Turm mit
einigen Kranauslegern erhebt. Er verbindet die Sockelzone mit der
Himmelszone in der oberen Fensterhälfte, deren horizontale Gliederung
in Grün-Blau-Tönen (vorherrschend grün) von einigen
weißen Wolkengebilden aufgelockert wird und die am obersten
Rand nochmals mit Gelb-Rot-Tönen abschließt. Dem linkerhand
angeordneten Turm schwebt im Himmel diagonal gegenüber das „zürnende
Auge Gottes“
|
 |
| Christof Grüger war mit dem bedeutenden Komponisten Wolfgang Fortner (http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Fortner) eng befreundet. Nach dessen Tod 1987 schuf er für ihn das Grabmal auf dem Friedhof Heidelberg-Handschuhsheim. Bedingt durch die deutsche Teilung konnte er nicht am Begräbnis teilnehmen. Die Entwurfszeichnung schickte er per Post nach Heidelberg, wo das Werk ausgeführt wurde. Wolfgang Fortner war insbesondere als Komponist von Zwölftonmusik bekannt, und so symbolisieren die zwölf Edelstahlstäbe durch ihre Länge die Notenwerte einer Zwölftonreihe von Wolfgang Fortner (möglicherweise aus der „Bluthochzeit“). Auch die Regel der Zwölftonmusik, dass sich ein Ton erst dann wiederholen darf, wenn zuvor alle anderen der Reihe erklangen, wird dargestellt. Der erste und der zwölfte Stab sind gleich lang bzw. die Töne gleich. |